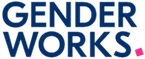Normen verändern Unternehmenskulturen chancengerechter
Vollzeitarbeit plus Überstunden? Anwesenheitspflicht? Tougher Führungsstil? Dauerverfügbarkeit? Das sind heute immer noch einige der Voraussetzungen, um in Unternehmen Karriere zu machen. Das ist zuweilen nicht nur ungesund, sondern schränkt auch Frauen und Männer in ihrer Lebensgestaltung ein. Wie geht es auch anders?
30-Stunden-Woche? Home-Office? Kooperativer Führungsstil? Akzeptanz von Care-Arbeit?
Das sind wünschenswerte Normen von Unternehmenskulturen um Chancengleichheit zu befördern. Aber sind das nur Utopien aus „Schöner Arbeiten“? Oder können wir das realisieren? Und wenn ja, wie?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt meines Workshops bei dem Netzwerktreffen der Working Moms.
Normen sind Mindsets
Zunächst ging es erst einmal darum zu klären, was eigentlich Normen sind: ungeschriebene Gesetze, unhinterfragte Selbstverständlichkeiten, soziale Werteordnungen, anerkannte nicht-diskutierbare Regeln. Meistens sind sie unsichtbar und sie lassen sich nirgends nachlesen. Wer neu in ein Unternehmen kommt, braucht meist einige Zeit, um sie zu erkennen - und kann zwischenzeitlich super in verschiedene Fettnäpfchen treten!
Normen geben aber auch Orientierung, Regelmäßigkeit und dienen als Entscheidungshilfe. Sie regeln das Zusammenleben, was wir dürfen und was nicht. In einem Unternehmen ohne Gleitzeitregelungen, Home-Office, Teilzeitmöglichkeiten - ja, das gibt es! Ich habe selbst ein solches beraten - sind es häufig nur die absoluten Optimist*innen die meinen daran etwas ändern zu können. Alle anderen sparen sich die Energie und akzeptieren das oder wechseln in eine anderes Unternehmen.
Als eine weitere Funktion von Normen dienen sie als Argumente gegen Veränderung. „Das haben wir schon immer so gemacht“ oder „Das gibt es bei uns nicht“ sind sicherlich Beispiele, die wir alle kennen - und die eher etwas grobschlächtiger sind. Ebenso bekannt aber ein wenig feinsinniger sind möglicherweise witzig gemeinte Bemerkungen von Kolleg*innen, ob man mal wieder nur einen halben Tag arbeite, wenn man gegen 16.00 Uhr Feierabend macht. Witzig ist diese Bemerkung übrigens nur für jene, bei denen das keinen Rechtfertigungsreflex oder schlechtes gewissen auslöst, weil sie beispielsweise keine Zwänge haben, um Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren.
Normen torpedieren Maßnahmen zur Chancengleichheit
Normen sind also wesentlicher Bestandteil von Unternehmenskulturen. Beides ist schwer greifbar. Beides führt dazu, dass Aktivitäten für mehr Chancengleichheit ins Leere laufen. Immer wieder bekomme ich in Unternehmen beispielsweise zu hören: „Wir haben doch bereits eine ganze Reihe von Maßnahmen, aber trotzdem steigt der Anteil von Frauen in Führungspositionen nicht!“
Ein Grund dafür könnte sein, dass sich weder die Unternehmenskultur noch die Normen entsprechend verändert haben: Das Mindset der Führungskräfte und Beschäftigten ist gleich geblieben. Ein Beispiel: Das Unternehmen hat eine Betriebsvereinbarung getroffen, dass bis 20 % der Arbeitszeit im Home-Office geleistet werden können - das bedeutet einen Tag pro Woche. Eine tolle und wichtige Maßnahme für flexibleres Arbeiten. Nach einem Jahr statistischer Erfassung stellt sich heraus, dass nur ganz selten jemand im Home-Office arbeitet. Das liegt nicht unbedingt daran, dass nicht alle Tätigkeiten, wie zum Beispiel im Außendienst, im Home-Office erledigt werden. Auf Nachfrage stellt sich nämlich heraus, dass Vorgesetzte es schaffen, ihre Mitarbeitenden vom Home-Office fernzuhalten. Dies geschieht beispielsweise über Bemerkungen wie: „Ach, das hätte ich ja nicht von ihnen gedacht, dass sie einen Haushaltstag brauchen!“ oder „Das geht nur, wenn sie mir vorab klar definierte Arbeitspakete einreichen, die sie dann erledigen werden.“ Das zugrundeliegende Mindset ist hier: Kontrolle. Was fehlt ist: Vertrauen.
Hinderliche Mindsets
Ein weiteres gewichtiges Mindset zur Verhinderung von Chancengleichheit ist das Verständnis von Führung. Hier greifen häufig zwei Annahmen:
- Fachkompetenz ist wichtiger und höher bewertet als Führungskompetenz.
- Führungskompetenz bedeutet Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreude, Konfliktfähigkeit, Sachlichkeit etc.
- Führung erfordert „den ganzen Mann“.
Selbstverständlich ist es sinnvoll, wenn eine Führungskraft fachlich versiert ist - das gilt sowohl für technische Bereiche als auch für Dienstleistungen. Diese gelten als „hard facts“, bestehend aus fachlich passgenauem Studienabschluss, mehrjähriger Berufserfahrung in genau diesem Bereich etc. Ergänzt werden sie um so genannte „soft skills“, um soziale Kompetenzen, die eine Führungskraft außerdem wünschenswerter weise - aber nicht notwendiger weise - mitbringen sollte. Häufig gilt es immer noch als „nice to have“ bei der Auswahl von Führungskräften, wenn diese in der Lage ist mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren, Feedback zu geben und zu erhalten, zu delegieren, Mitarbeitende zu motivieren und anzuleiten, auch vertikal und bereichsübergreifend zu vermitteln etc. Diese Sichtweise ist aber ein großes Manko! In einer digitalisierten Arbeitswelt mit sich rasend schnell veränderten Techniken und Technologien, mit einem Übermaß an Informationen, mit globalisierten Teams etc. sollte es keine Führungskraft mehr geben, die nicht über mindestens genau so ausgeprägte Führungs- wie Fachkompetenzen verfügt. Ich schlage vor, die Trennung zwischen „hard facts“ und „soft skills“ aufzuheben und Führungskompetenzen mindestens ebenbürtig zu Fachkompetenzen zu werten.
Gleichzeitig gilt es die Zuschreibungen von Führungskompetenzen zu überdenken und neu zu fassen: Auch hierbei ist es natürlich sinnvoll, wenn eine Führungskraft in der Lage ist, sich durchzusetzen, Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu lösen und dabei sachlich zu bleiben. Hinderlich für Chancengleichheit ist nur, dass diese Eigenschaften derzeit überwiegend Männern zugeschrieben werden. Die meisten Menschen sehen bei diesen Begriffen vor ihrem innerlichen Auge meist große, weiße, mittelalte Männer, die auch mal rumpoltern, ein Machtwort sprechen und mit der Hand auf den Tisch hauen (können). Aber das ist von gestern! Zeitgemäßer sind Führungsstile die partizipativ und kollaborativ sind, Entscheidungen, bei denen die Teams (d.h. die Fachkräfte) eingebunden werden, Konfliktlösungen, die sowohl Fehlerkulturen als auch Diversity-Perspektiven berücksichtigen. Erfahrungsgemäß verbessern sich dadurch die Ergebnisse - und gleichzeitig haben Frauen bessere Chancen auf eine Führungsposition.
Dass Führung „den ganzen Mann“ erfordert, bedeutet eine Führungskultur, die Dauerverfügbarkeit sowie Dauerpräsenz verlangt und Familienverantwortung aller höchstens nur in Notfällen zulässt. Der ganze Mann ist also rund um die Uhr - physisch wie mental - für das Unternehmen im Einsatz. Andere Lebensbereiche dürfen keine Kapazitäten abziehen. Wie gesagt, ist dies nicht nur ungesund, sondern verhindert den Zugang zu Führungspositionen für alle, die außerhalb des Jobs noch ein Leben haben (wollen). Hierbei geht es vor allem um Mütter und Väter, die Beruf und Familie zu vereinbaren haben. Gleichzeitig sind auch Frauen und Männer gemeint, die ehrenamtlich tätig sind, Hobbies und Freizeitaktivitäten schätzen, ihr Privatleben und Freundschaften pflegen.
Mindsets und Normen verändern
Was können wir nun tun, um Mindsets und Normen zu verändern?!
Die weniger gute Nachricht gleich vorweg: Es braucht Zeit, Wiederholungen, einen langen Atem und immer wieder verschiedene Aktivitäten.
Einen Bewusstseinswandel herbei zu führen geschieht nicht über Nacht.
- Hilfreich sind Gespräche, Austausch und Diskussionen - das ist keine neue Erkenntnis, aber trotzdem bleibt es passend.
- Gute Beispiele im eigenen Unternehmen oder von anderen helfen ebenso, dass jemand auch mal etwas ausprobiert.
- Den Nutzen und die Vorteile zu kommunizieren, trägt dazu bei, das Anliegen zu versachlichen.
- Auch negative Erfahrungen können zu Veränderungen führen, z.B. wenn sich keine Fachkraft für die Stelle findet, weil die Kandidat*innen andere Werte und Normen haben. Vorbilder finden und kommunizieren trägt auch zur Gewöhnung bei.
- Fortbildungen zu Unconscious Bias erhöhen die (Selbst-)Reflexion und können zu Veränderungen besonders dann führen, wenn sie mit konkreten Aufgaben und Anliegen aus dem Arbeitsalltag verknüpft werden.
- Die Unterstützung der Geschäftsführung setzt positive Signale.
- Bisherige Maßnahmen weiterhin durchzuführen und am Ball zu bleiben verdeutlicht, dass das Thema „nicht wieder weggeht“.
- Ungewohnte Formate können überraschen und sensibilisieren, z.B. ein Quiz im Intranet zu Diversity, eine wiederkehrende Speakers-Corner in der Kantine, eine Open-Space Veranstaltung zum Thema, eine aktuelle Fragestunde der Geschäftsführung im Aufzug fahrend.
- Die Setzung von neuen Normen, wie zum Beispiel die Festlegung der 30-Stunden-Woche - so erzählt mir eine Diversity Beauftragten in einem Unternehmen. Die Idee ist, dass die Beschäftigten natürlich auch mehr arbeiten können, aber sie müssen dies begründen. Dadurch verändert sich die Vollzeit-Norm, bei der sich üblicherweise jene erklären müssen, die weniger arbeiten wollen.
- All dies und vermutlich noch viel mehr trägt zur „Gewöhnung an Ungewohntes“ bei und damit zur Veränderung von Mindsets und Normen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Normen und Werte in Ihrem Unternehmen gemacht? Welche fördern oder behindern Chancengleichheit? Welche Aktivitäten haben Sie ergriffen? Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen an post@genderworks.de